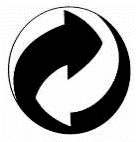Der Brexit und der Übergangszeitraum – Was bedeutet das für Ihre EU-Marke?
Am 31. Jänner 2020 war es soweit: Das Vereinigte Königreich (UK) hat die Europäische Union verlassen. Damit hat nun der sogenannte „Übergangszeitraum“ begonnen, der bis 31. Dezember 2020 läuft und den Zweck hat, die inhaltlichen Folgen des Brexits zu verhandeln und zu regeln. Während dieses Zeitraums bleibt das UK noch Mitglied des einheitlichen europäischen Marktes und der Zollunion, die meisten Auswirkungen zeigen sich somit erst im Jahr 2021. Während britische Marken vom Brexit grundsätzlich unberührt bleiben, stellt sich die spannende Frage, was nach dem Übergangszeitraum mit EU-Marken und EU-Designs passiert, da das geografische Schutzgebiet dieser Rechte schrumpft und UK endgültig zum Drittstaat wird.
Die gute Nachricht gleich vorweg: Inhaber von aufrechten EU-Marken und EU-Designs werden automatisch und voraussichtlich kostenlos entsprechende nationale Rechte in UK (UK-Marke/UK-Design) erhalten.
Anders ist es allerdings bei Anmeldungen von EU-Marken oder EU-Designs, die am 31. Dezember 2020 noch anhängig sind. Diese werden nicht automatisch in eine entsprechende Anmeldung in UK umgedeutet. Der Anmelder hat jedoch die Möglichkeit, bis Ende September 2021 um Registrierung der gleichen Marke oder des gleichen Musters in UK anzusuchen, wobei er das Prioritätsdatum der EU-Anmeldung mitnehmen kann. Hier besteht somit Handlungsbedarf.
Hinsichtlich Laufzeit und Priorität des Rechts geht man im Moment davon aus, dass die Erneuerungsdaten und Anmelde- bzw. Prioritätsdaten der abgeleiteten Schutzrechte in UK jenen der zugrunde liegenden EU-Marken oder EU-Designs entsprechen.
Eine der Herausforderungen in diesem Zusammenhang ist die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Marke. Sollte diese etwa als EU-Marke in mehreren Ländern Europas verwendet worden sein, nicht jedoch in UK, so könnte das zu einem Problem für die abgeleitete Marke in UK werden. Dazu sehen die Übergangsbestimmungen immerhin vor, dass der Umstand, dass sie vor dem Ende der Übergangsperiode nicht in UK benützt wurde, nicht gegen die abgeleitete UK-Marke verwendet werden und darauf weder ein Widerruf noch eine Löschung gestützt werden können. Trotzdem ist zu empfehlen die Benützung auch in UK im Auge zu behalten.
Eine der wesentlichen Fragen im Zusammenhang mit dem Brexit ist, wie mit der Erschöpfung des Markenrechts zwischen der EU und UK umgegangen wird. Innerhalb des EWR kann der Markenrechtsinhaber Dritten grundsätzlich sein Markenrecht nicht entgegenhalten, wenn Waren unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung im EWR in Verkehr gebracht worden sind, sein Markenrecht ist also erschöpft. Dies gilt jedoch nicht für Originalwaren, die in Drittstaaten in Verkehr gebracht worden sind:
Mit Austritt vom UK aus der EU gilt diese Erschöpfung daher grundsätzlich nicht mehr. In einer Verordnung hat die Regierung des UK nun festgelegt, dass das Markenrecht für Produkte, die nach dem 31. Dezember 2020 im EWR in Verkehr gebracht werden, weiterhin für das UK als erschöpft gelten sollen. Damit kann sich also ein Markeninhaber aus diesem Grund nicht dem Import oder Vertrieb von derartigen Waren in UK widersetzen.
Für die EU gibt es dazu über den Übergangszeitraum hinaus noch keine Regelungen, sodass sich Markeninhaber grundsätzlich gegen einen Parallelimport der von ihnen selbst oder mit ihrer Zustimmung im UK in Verkehr gesetzten Waren in den EWR widersetzen könnten. Hier bleibt es abzuwarten, welche Ergebnisse die Verhandlungen bringen.
Auch für Lizenzverträge könnte Handlungsbedarf bestehen: Einmal stellt sich die Frage nach der geographischen Geltung. Lizenzverträge, die ausschließlich die Europäische Union ohne weitere Spezifikation angegeben haben, werden daher in diesem Punkt auslegungsbedürftig. Diesbezüglich empfiehlt sich ein Blick in die bestehenden Lizenzverträge oder entsprechende Formulierungen, sollten in nächster Zeit Lizenzverträge ausgehandelt werden. Dann stellt sich die Frage, welche Marken oder Designs überhaupt lizensiert worden sind. Zwar wird es eine von der EU-Marke abgeleitete Marke des UK geben, diese wird in der Regel aber nicht im Lizenzvertrag angeführt sein. Noch komplizierter kann sich die Situation darstellen, wenn es sich um einen Lizenzvertrag handelt, der auf einer EU-Marke basiert, aber nur für UK gelten soll. Hier sehen zwar die Übergangsbestimmungen des UK vor, dass die neue UK-Marke ohne ausdrückliche Änderung Gegenstand der Lizenz wird. Es empfiehlt sich jedoch, dies im Detail anzusehen. Schließlich ist noch zu beachten, ob der Lizenzvertrag im Register eingetragen ist, und wenn ja, in welchem. Die UK-Übergangsbestimmungen sehen jedenfalls vor, dass auch eine Lizenz auf der Grundlage einer EU-Marke nach dem 31. Dezember 2020 im Markenregister des UK eingetragen werden kann.