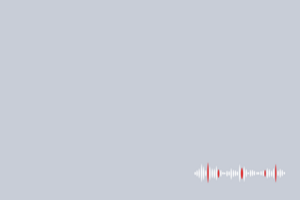Neue EU Richtlinie zum Insolvenzrecht auf der Zielgeraden – Rat und Parlament ebnen Weg für Trilogverhandlungen
Vor nunmehr schon fast drei Jahren, am 7. Dezember 2022, hat die Europäische Kommission einen Vorschlag für eine Richtlinie zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Insolvenzrechts (COM (2022) 702 final) (der „Kommissionsvorschlag“) veröffentlicht. Ziel der Initiative ist eine weitere Harmonisierung bei Insolvenzen innerhalb der Europäischen Union. Eingebettet ist dieses Vorhaben in andere Maßnahmen zur Weiterentwicklung der EU Kapitalmarktunion.
Mit dem Kommissionsvorschlag haben wir uns bereits an anderer Stelleausführlich auseinandergesetzt. Seit Ende Mai liegt die Position des Rats der Europäischen Union vor, die in der Allgemeinen Ausrichtung (die „AAR des Rats“) zusammengefasst ist. Wenig später wurde nunmehr Anfang Juli auch die Stellungnahme des Europäischen Parlaments (die „EP-Stellungnahme“) veröffentlicht.
In diesem Beitrag fassen wir die wesentlichsten Änderungen im Vergleich zum Kommissionsvorschlag zusammen, wobei wir uns insbesondere auf das Insolvenzanfechtungsrecht, die Pflichten der Unternehmensleitung und den Pre-pack-Mechanismus konzentrieren. Nachdem das Gesetzgebungsverfahren nach wie vor im Gange ist, gehen wir nicht auf sämtliche Details ein. Es fällt auf, dass die Position des Rats und des Parlaments vielfach voneinander abweichen – wo relevant weisen wir auf Unterschiede hin.
1. Änderungen im Vergleich zum Kommissionsvorschlag
1.1. Richtlinie bringt „nur“ Mindestharmonisierung
Sowohl die AAR des Rats als auch die EP-Stellungnahme betonen, dass es sich um eine Mindestharmonisierung handelt. Den Mitgliedstaaten steht es daher grundsätzlich frei, strengere oder weitgehendere Rechtsvorschriften zu erlassen, solange diese im Einklang mit dem Unionsrecht stehen. Gleichzeitig wird bei den Definitionen in Art 2 klargestellt, dass für die Zwecke der Richtlinie die Begriffe „Insolvenz“ (insolvency) und „Unternehmensleiter“ (director) nach den nationalen Regelungen der Mitgliedstaaten zu verstehen sind und somit auch zukünftig nicht harmonisiert sein werden. Diese „heißen Eisen“ werden also auch weiterhin nicht angefasst.
1.2. Anfechtungsrecht (Titel II)
- In Sachen Insolvenzanfechtung wurden im Vergleich zum Kommissionsvorschlag ein paar Formulierungen und Details angepasst, im Wesentlichen bleiben die Bestimmungen aber unverändert.
- Sowohl in der AAR des Rats als auch in der EP-Stellungnahme wurde der Anfechtungstatbestand der Gläubigerbevorzugung bei kongruenten Befriedigungen oder Sicherstellungen in Art 6 Abs 2 dahingehend „entschärft“, dass nur noch die tatsächliche Kenntnis des Anfechtungsgegners von einer Insolvenz des Schuldners zu einer Anfechtung führen soll, die „lediglich“ fahrlässige Unkenntnis aber nicht. Hier sind die österreichischen Bestimmungen der §§ 30, 31 IO strenger. Weil es sich um eine Mindestharmonisierung handelt, dürfte Österreich diese Bestimmungen beibehalten, könnte sich aber natürlich auch an dem weniger strengen Maßstab der Richtlinie ausrichten.
- Bei der Absichtsanfechtung gemäß Art 8 der Richtlinie wurde die Anfechtungsfrist in der AAR des Rats auch auf Wunsch von Österreich (Eriksson, ZIK 2025/7) von vier auf zwei Jahre verkürzt. In der EP-Stellungnahme wird eine Frist von drei Jahren gefordert.
- Die im Kommissionsvorschlag noch vorgesehene dreijährige Verjährungsfrist für Insolvenzanfechtungsansprüche (gerechnet ab Insolvenzeröffnung) wurde in der AAR des Rats wieder gestrichen. Damit stünden allfällige Widersprüche zur 1-jährigen Frist nach § 43 Abs 2 IO nicht mehr im Raum. In der EP-Stellungnahme ist die 3-Jahresfrist aber weiterhin vorgesehen.
- Insgesamt bleibt es bei unserer Einschätzung, dass die Anfechtungsbestimmungen, wenn sie so kommen, keinen nennenswerten Änderungsbedarf in Österreich auslösen würden.
1.3. Pre-pack Verfahren (Titel IV)
- Die Regelungen zu Pre-pack Verfahren (in der AAR des Rats wurde die Bezeichnung auf Pre-pack-Mechanismus abgeändert) sind im Vergleich zum Kommissionsvorschlag in den wesentlichen Punkten unverändert. Rat und Parlament haben aber einzelne Regelungen präzisiert und (Gläubiger-)Schutzmechanismen ergänzt.
- Sowohl die AAR des Rates als auch EP-Stellungnahme wollen den Zugang zur Vorbereitungsphase insofern einschränken, dass zumindest eine wahrscheinliche Insolvenz des Unternehmens gegeben sein muss (die AAR des Rats lässt den Mitgliedstaaten hierzu aber die Wahl, ob diese Voraussetzung umgesetzt wird).
- Der Gläubigerschutz soll durch mehrere Maßnahmen verstärkt werden. Insbesondere muss das Kriterium des Gläubigerinteresses sichergestellt sein, das laut EP-Stellungnahme neben einer Zerschlagung explizit auch den „regulären“ Unternehmensverkauf im Insolvenzverfahren bzw laut AAR des Rats (wenn von den Mitgliedstaaten vorgesehen) das nächstbeste Alternativszenario enthalten soll.
- Laut EP-Stellungnahme muss sichergestellt sein, dass der Schuldner in der Vorbereitungsphase in Eigenverwaltung (debtor in possession) bleibt.
- Während im Kommissionsvorschlag noch vorgesehen war, dass Schuldner während der Vorbereitungsphase auch Zugriff zu einer Aussetzung von Einzelvollstreckungsmaßnahmen haben müssen, sieht die AAR dies nur mehr optional vor. Laut EP-Stellungnahme soll die Aussetzung für die Mitgliedstaaten weiterhin zwingend umzusetzen sein, was uE zu begrüßen ist.
- Viele Diskussionen gab es um die Regelung im Kommissionsvorschlag, dass noch zu erfüllende Verträge des Schuldners, die für den Fortbestand des Unternehmens notwendig sind, automatisch und insbesondere ohne Zustimmung der Gegenpartei an den Käufer abgetreten werden sollen. Sowohl Rat als auch Parlament sehen hierzu nun Möglichkeiten vor, die Abtretung unter gewissen Umständen auch von der Zustimmung der Gegenpartei abhängig zu machen. Die AAR des Rats sieht auch die Möglichkeit eines Kündigungsrechts der Gegenpartei vor.
- Erforderliche Zwischenfinanzierungen sollen laut AAR des Rats erleichtert werden und daher weder nichtig, anfechtbar oder unwirksam sein. Aus einer solchen Finanzierung soll auch keine Haftung jeglicher Art aus einer Gläubigerbenachteiligung entstehen können. Die Mitgliedstaaten sollen aber hierzu eine ex-ante-Kontrolle vorsehen können.
- Es bleibt dabei, dass sich durch ein solches Pre-pack Verfahren in Österreich so einiger Änderungsbedarf ergeben würde. Wie schon in unserem Blogbeitrag zum Kommissionsvorschlag ausgeführt, scheint aber eine Verknüpfung mit der bestehenden Insolvenzrechtsordnung gut möglich.
1.4. Pflichten der Unternehmensleitung (Titel V)
- Zu den im Kommissionsvorschlag vorgesehenen Pflichten der Unternehmensleitung zur Stellung eines Insolvenzantrags binnen drei Monaten ab Kenntnis von der Zahlungsunfähigkeit gab es aus einigen Mitgliedstaaten Kritik. Nicht alle Mitgliedstaaten kennen oder unterstützen das Konzept einer Insolvenzantragspflicht, wie es in Österreich oder auch Deutschland besteht. Es kommt daher nicht überraschend, dass sowohl Rat als auch Parlament hier Anpassungen fordern.
- In Art 36a der AAR wurde die Antragspflicht zweifach „aufgeweicht“.
- Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die „Antragspflicht“ dadurch erfüllt wird, dass anstelle der Insolvenzantragstellung durch den Schuldner die Zahlungsunfähigkeit binnen selber Frist öffentlich bekannt gemacht wird, damit dann Gläubiger einen Insolvenzantrag stellen können (Abs 2a); und
- für die Praxis deutlich relevanter – Mitgliedstaaten können vorsehen, dass Unternehmensleiter auch gleichwertige Maßnahmen setzen können, um einen Schaden für Gläubiger abzuwenden (Abs 3). Welche gleichwertigen Maßnahmen das wären, bleibt offen, was zu Rechtsunsicherheit führen könnte.
- Auch die EP-Stellungnahme enthält ähnliche Vorschläge, die aber nur für Unternehmensleiter gelten sollen, die persönlich für die gesamten Gesellschaftsverbindlichkeiten haften.
- Für das österreichische Recht bleibt es dabei, dass solche Reglungen in der Richtlinie keinen Änderungsbedarf mit sich bringen würden. Bleibt es bei den in der AAR geforderten Anpassungen ist davon auszugehen, dass auch in Mitgliedstaaten, die keine explizite Insolvenzantragspflicht vorsehen, kein erheblicher Änderungsbedarf mit einer neuen Richtlinie verbunden wäre.
1.5. Liquidation zahlungsunfähiger Kleinstunternehmen (Titel VI)
- Aufgrund vielfach geäußerter Bedenken kommt nicht ganz überraschend die Entscheidung des Rats und auch des Parlaments, die Bestimmungen zur Liquidation zahlungsunfähiger Kleinstunternehmen gänzlich zu streichen. Neben Bedenken an der praktischen Anwendbarkeit und möglicher Auswirkungen auf bestehende nationale Systeme waren auch Unsicherheiten hinsichtlich des Begriffs des „Kleinunternehmers“ und des Verfahrensumfangs ausschlaggebend. Mit Blick auf die in Österreich gerade für kleine Unternehmen sehr gut und effizient funktionierenden Insolvenzverfahren sind das gute Nachrichten.
- Etwas versteckt aber doch hat die EP-Stellungnahme in Artikel 3a aber vorgesehen, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen sollen, dass Kleinstunternehmen auch Zugang zu Insolvenzverfahren haben, wenn der Schuldner kein Vermögen hat oder das Vermögen nicht ausreicht, um die Kosten des Verfahrens oder des Insolvenzverwalters zu decken. Wenn es dabei bleibt, könnte dies im österreichischen Insolvenzrecht, das ja auch die Nichteröffnung mangels Masse vorsieht, Änderungsbedarf bringen.
1.6. Sonstiges
Auch bei den sonstigen Titeln haben Rat und Parlament noch einige Anpassungen vorgeschlagen. Abgesehen von Titel VI (siehe zuvor) sind aber alle Titel verblieben.
2. Fazit und Ausblick
Wie bei der letzten insolvenzrechtlichen Richtlinie (EU) 2019/1023 zu Restrukturierung und Insolvenzrecht scheinen die Verhandlungen auf EU-Ebene vielfach zu Kompromisslösungen und Aufweichungen zu führen, um auf die größten Bedenken aus Mitgliedstaaten Rücksicht zu nehmen. Den Mitgliedstaaten dürfte daher auch dieses Mal – zulasten einer tiefergreifenden Harmonisierung – bei der Umsetzung einiges an Spielraum bleiben. Ebenso scheint es dabei zu bleiben, dass grundsätzliche und wesentliche Aspekte wie etwa die Bedeutung des Begriffs „Insolvenz“ (insolvency) weiterhin nicht harmonisiert werden.
Die Bedeutung der geplanten Richtlinie für Österreich ist nach den nun vorliegenden Stellungnahmen überschaubar. Während sich in anderen Mitgliedstaaten in vielen Bereichen (teils erheblicher) Änderungsbedarf ergeben könnte, würde hierzulande das Pre-pack Verfahren wohl die größten Umsetzungsarbeiten mit sich bringen.
Nachdem sowohl Rat als auch Parlament nun kurz hintereinander ihre Positionen veröffentlicht haben, scheint auf EU-Ebene ein Momentum zu bestehen, das zu einem schnellen Abschluss der nun anstehenden Trilogverhandlungen führen könnte. Vielfach wird eine Verabschiedung der neuen Richtline bereits Anfang 2026 erwartet. Wie lange die Mitgliedstaaten dann Zeit für eine Umsetzung haben, bleibt abzuwarten: Der Kommissionsvorschlag sah eine 2-jährige Umsetzungsfrist vor, der Rat fordert 3 Jahre, das Parlament hingegen nur 1 Jahr. Unabhängig davon scheint die neue Richtlinie aber auf der Zielgeraden zu sein.
Hinweis: Dieser Blog stellt lediglich eine generelle Information und keineswegs eine Rechtsberatung von Binder Grösswang Rechtsanwälte GmbH dar. Der Blog kann eine individuelle Rechtsberatung nicht ersetzen. Binder Grösswang Rechtsanwälte GmbH übernimmt keine Haftung, gleich welcher Art, für Inhalt und Richtigkeit des Blogs.